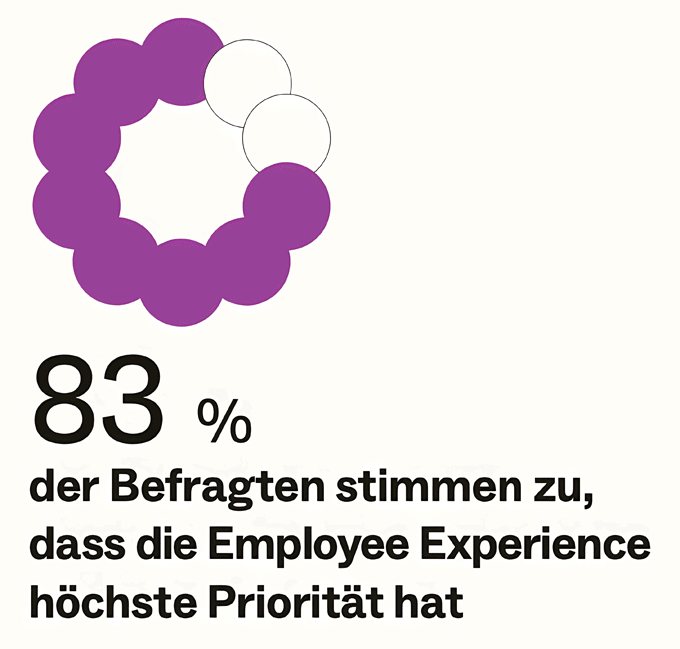Zeitalter der KI: Regionen müssen mehr zusammenarbeiten
Im Rahmen des 77. Locarno Film Festival organisierte digitalswitzerland einen Event zum Thema künstliche Intelligenz mit Fokus auf die Schweiz, Technologie in der Kunst und die Macht der Zusammenarbeit zwischen den Regionen.

Die Organisation digitalswitzerland hat es zu ihrer Aufgabe gemacht, die Privatwirtschaft, den öffentlichen Sektor, die akademische Gemeinschaft und die Bevölkerung aller Sprachregionen der Schweiz entlang einer digitalen Agenda zu vereinen. Eine solche Agenda soll dazu führen, dass die Schweiz eine führende Nation in Bezug auf Innovation, Wirtschaftsstandort und digitale Wettbewerbsfähigkeit wird. Vor diesem Hintergrund fanden auf Einladung von digitalswitzerland am 7. August Expertinnen und Experten, Visionärinnen und Visionäre, Branchenpionierinnen und -pioniere sowie innovative Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor wie auch aus der Wissenschaft im PalaCinema Locarno zusammen, um die revolutionären Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die moderne Geschäftswelt aufzuzeigen. Drei zukunftsweisende Fragen standen im Zentrum des Anlasses: Wie kann sich das Schweizer Creative-Tech-Ökosystem entwickeln? Wie kann die Schweiz von den Supercomputern im Tessin profitieren? Warum müssen die Regionen im Zeitalter der KI ihre Kräfte bündeln?
Die Zukunft des Films und der audiovisuellen Künste
Raphaël Brunschwig, Geschäftsführer des Locarno Film Festival, Andreas Meyer, Präsident von digitalswitzerland, und Stefan Metzger, CEO von digitalswitzerland eröffneten den Anlass. Es folgten Stefano Rizzi, Leiter der Abteilung für Wirtschaftsangelegenheiten des Kantons Tessin, und Mauro Silacci, Leiter der Finanz- und Wirtschaftsabteilung der Stadt Locarno, mit einigen einleitenden Worten.
Im Zusammenhang mit dem Locarno Film Festival nahm die Kunst einen besonderen Platz ein. Kevin B. Lee, Professor für die Zukunft des Kinos und der audiovisuellen Künste an der Università della Svizzera italiana (USI), warf Fragen über den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Kunst, Kunstschaffende und speziell auf das Kino auf: Wie wird sich die Bedeutung des Kinos in den kommenden Jahren entwickeln? Wie stellt sich das Kino sein eigenes Überleben vor? Wie setzen Künstlerinnen und Künstler diese neue Technologie ein – und wie ordnet das Publikum KI-generierte Kunst ein? Sein Fazit, inspiriert durch Microsofts Schlussworte an den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2024: Künstliche Intelligenz ist nicht kreativ – Sie sind es. Aber das „Sie“ definiert den Wert, den Grad an Akzeptanz und die zumutbare Disruption, die KI mit sich bringt.
KI und ihre vielen Facetten: von Creative Tech bis hin zum Schweizer Supercomputer
Marco Zaffalon, Professor am Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence (IDSIA, USI-SUPSI), erläuterte zunächst die Geschichte der künstlichen Intelligenz sowie ihre aktuellen Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Dabei ging er auf die damit verbundenen Probleme ein. Er betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Instituten, Politik und der Industrie, um Technologien und Fähigkeiten in der Schweiz zu entwickeln.
Christoph Weckerle vom Zurich Centre for Creative Economies beleuchtete Veränderungen in der Nutzung von KI in der Kulturbranche. Gemäss Weckerle wurde KI genutzt, um kulturelle Inhalte zu verbreiten – heute, um sie zu produzieren. Dies führe zu Veränderungen, welche die Branche revolutionieren würden. Im Creative-Tech-Bereich sei die Schweiz noch unterentwickelt – Weckerle verweist dabei auf einen Mangel an Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Er betonte auch, wie wichtig es sei, eine schweizerische strategische Agenda für diesen Bereich zu entwickeln. Es gebe also noch viel Raum für Fortschritt. Giulia Lumina, ESG- und Nachhaltigkeitsmanagerin bei Andersen Tax and Consulting AG, erläuterte, wie KI sie bei der Erreichung ihrer Ziele unterstütze.
Maria Grazia Giuffreda, Vizedirektorin des Schweizerischen Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (CSCS), und Michele de Lorenzi, stellvertretender Direktor, gaben einen exklusiven Einblick in die die Möglichkeiten des neuen Tessiner Zentrums und seines Supercomputers „Alps“, welches am 14. September seine Türen öffnet. Der Supercomputer wirke als Katalysator für den technologischen Fortschritt in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vertrauenswürdige Infrastruktur. Beide betonten die zentrale Rolle des Supercomputers als Element des Vertrauens, der Innovation und der Zusammenarbeit in der Schweiz.
Die Kräfte bündeln
Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion darüber, wie wichtig es im Zeitalter von KI für die Schweizer Regionen ist, ihre Kräfte zu bündeln und welche Hindernisse es dabei zu überwinden gilt. Milena Folletti, Beauftragte für digitale Transformation des Kantons Tessin, Sophie Hundertmark, Beraterin für GenAI und Bots, und Marco Zaffalon tauschten sich zu diesem Thema aus. Aus der Diskussion ging hervor: Verstärkte Zusammenarbeit bündelt Ressourcen, treibt Innovation voran, stärkt das Vertrauen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Doch Hindernisse wie regionale Autonomie, fehlende öffentlich-private Partnerschaften und unterschiedliche Rechtsvorschriften bremsen den Fortschritt.
Der Staatsratspräsident des Kantons Tessin, Christian Vitta, schloss die Diskussion mit folgenden Themen ab: die Fortschritte, die die künstliche Intelligenz in allen Branchen ermöglicht hat, die Rolle, die das Tessin bei der technologischen Innovation gespielt hat, und die Notwendigkeit einer gross angelegten interregionalen Zusammenarbeit.
Quelle: digitalswitzerland