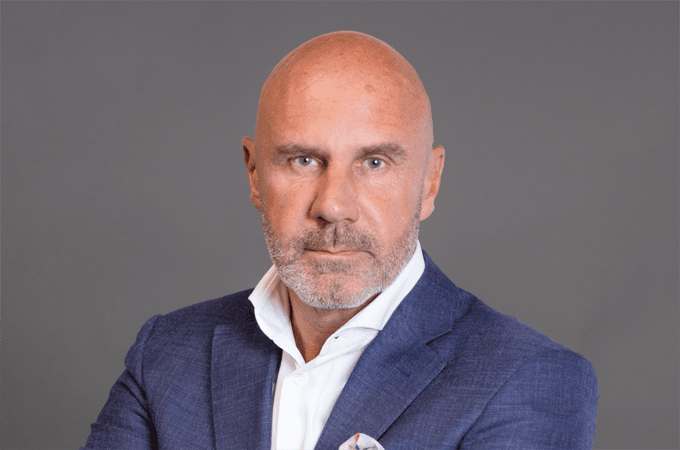Basis für Nachhaltigkeit
Viele Unternehmen nutzen bereits seit Langem ein Umweltmanagementsystem (UMS) nach ISO 14001. Dabei kann besonders für KMU das UMS eine wertvolle Grundlage sein, um ein umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren und über seine Leistungen in diesem Bereich zu berichten.

Viele KMU können sich auf den ersten Blick nur wenig vorstellen, was das Konzept der gesellschaftlichen Verantwortung mit ihrer Tätigkeit zu tun hat. Wenn man aber genauer hinsieht, sind sie bezüglich gesellschaftlich- sozialer Aspekte oft engagierter, als ihnen selber und ihrem Umfeld bewusst ist. Grund dafür ist, dass Schweizer KMU häufig noch persönlich von der Besitzerfamilie geführt werden und daher meist eine relativ enge Verbindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Firmenstandorten haben.
Über die Umwelt hinaus
Umweltaktivitäten werden bereits seit Längerem wahrgenommen und als Beitrag des Unternehmens zur Nachhaltigkeit gesehen. Allerdings wird Nachhaltigkeit – schon seit einiger Zeit und zu Recht – immer breiter unter Einbezug sozial-gesellschaftlicher Themen verstanden. Dabei handelt es sich um Aspekte wie: Wie geht ein Unternehmen mit sei-
Elegante Lösung für KMU
nen Mitarbeitern um? Werden diese fair und nicht-diskriminierend behandelt? Gibt es Lohngleichheit von Mann und Frau? Sind die Arbeitsbedingungen sicher, gesund und motivierend? Und wie sieht es in der Lieferantenkette aus? Besteht das Risiko, dass dort Menschenrechte und grundlegende Arbeitsbedingungen verletzt werden? Wird die Einhaltung grundlegender Standards kontrolliert? Wird Verantwortung für Sicherheit und Ökologie von Produkten übernommen und Bezug auf die Bedürfnisse von Kunden/ Verbrauchern genommen? Welchen Einfluss hat und welche Beziehung unterhält das Unternehmen mit der Standortgemeinde oder der Region? Mit diesen Fragen sind noch nicht alle, aber doch einige wichtige mögliche Aspekte benannt.
UMS als Ausgangspunkt
Das Aufgreifen der Umweltschutz- Thematik durch die Unternehmen führte in vielen Fällen zur Entscheidung, ein Umweltmanagementsystem einzuführen. Als hauptsächlicher Nutzen dieser Einführung zeigte sich in der Regel die interne Systematisierung der Aktivitäten, welche auch die Sicherheit brachte, dass – durch IST-Analyse und Ablauflenkung – keine «blinden Flecken» zurückblieben und dass ein Treiber für Zielsetzung und Weiterentwicklung des Engagements installiert war. Ausserdem bot das UMS-Zertifikat nach ISO 14001 die Möglichkeit, das Engagement der Firma nach aussen darzustellen. Warum sollte man dies dann nicht auch um gesellschaftlich-soziale Nachhaltigkeitsaspekte erweitern? Dafür bietet ein UMS eine ideale Grundlage, denn dieses stellt bereits die meisten relevanten Elemente für ein Nachhaltigkeitsmanagement zur Verfügung, durch welches u.a. Prozesse für die Erhebung und Weitergabe von Daten im Unternehmen etabliert sind.
Das vorhandene Umweltmanagement braucht lediglich sinnvoll ergänzt und ausgebaut zu werden. Dies gilt auch für das Qualitätsund Arbeitssicherheitsmanagement, allerdings in geringerem Mass, da hier zwar auch die Struktur vorhanden ist, aber nicht, wie beim UMS, bereits wichtige inhaltliche Nachhaltigkeitsaspekte abgedeckt sind.
Wo besteht Handlungsbedarf?
Die Grundelemente des UMS, welche den Schritten PLAN – DO – CHECK – ACT («Managementzyklus ») folgen, lassen sich zumeist recht einfach um Themen aus dem gesellschaftlich-sozialen
Nachhaltigkeitsaspekteergänzen
Bereich erweitern. Grundvoraussetzung ist allerdings zunächst einmal eine Standortbestimmung des Unternehmens in Bezug zur gesellschaftlichen Verantwortung (CSR). Dazu bestehen verschiedene Instrumente, welche sich an der internationalen Richtlinie für gesellschaftliche Verantwortung, ISO 26000, orientieren. ISO 26000 behandelt Themen gesellschaftlicher Verantwortung und Vorgehensweisen für deren Umsetzung im Unternehmen. Sie beschreibt unter anderem sieben Kernthemen: Organisationsführung, Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt, faire Geschäfts- und Betriebspraktiken, Konsumentenanliegen und Einbindung der Gemeinschaft. Für die Umsetzung wird der Einbezug von Anspruchsgruppen als wichtige Praktik genannt. Zwei Instrumente der Analyse der CSR-bezogenen Handlungsfelder und Aktivitäten wurden in früheren MQArtikeln bereits ausführlich beschrieben (siehe Kasten).
Anschliessend sollten aus Unternehmersicht entsprechende Prioritäten gesetzt werden, je nachdem, wo das Unternehmen entsprechenden Handlungsbedarf sieht, externen Anforderungen ausgesetzt ist oder Möglichkeiten zur Profilierung sieht. Für eine vertiefte CSR-Analyse ist es angebracht, auch die Sichtweisen ausgewählter Anspruchsgruppen zu erfassen. Diese Informationen können dann auch als Grundlage für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie genutzt werden.
Von der Umwelt- zur CSRPolitik
Diese Analyse ergänzt die Umwelt(U)-Relevanzanalyse zu einer vollständigen CSR-Analyse. Die anderen Elemente des Umweltmanagementsystems können nun entsprechend erweitert werden: Die Umweltpolitik wird zur CSR-Politik ausgebaut. Dazu kann sich das Unternehmen an den erarbeiteten Prioritäten sowie an den Grundprinzipien der ISO 26000 orientieren. Die Umweltkennzahlen werden zu CSR-Kennzahlen erweitert. Dabei sollten die Indikatoren der Global Reporting Initiative (GRI) berücksichtigt werden, welche den international anerkannten Standard für transparente Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt. Ebenso werden die Umweltziele zu CSR-Zielen weiterentwickelt. Ähnlich unproblematisch ist die Ausweitung von Umwelt-Monitoring und internen Audits auf den gesamten Nachhaltigkeitsbereich. Zuletzt wird das Umweltmanagement- Review zu einem CSR-Review ergänzt. Wie dies aussehen kann, zeigt die Grafik 1.
Etwas umfangreicher stellt sich in der Regel die Ablauflenkung für die CSR-relevanten Aspekte des Unternehmens dar. Je nach Tätigkeitsfeld und gesetzten Prioritäten sind dies beispielsweise Ver-
Zertifizierung wird möglich
pflichtung und Kontrolle von Lieferanten bzgl. Menschenrechten, Berücksichtigung von Diversitätsund Chancengleichheitsaspekten im Personalmanagement, Management des Sponsoring von Gemeinschaftsakti-vitäten, Gesundheitsmanagement oder die Entwicklung und Umsetzung von Antikorruptionsvorgaben. Je nach bereits bestehendem Engagement des Unternehmens können auch bei diesen Themen schon diverse (Teil-)Prozesse in der Firma vorhanden sein.
Sind die in Grafik 1 dargestellten Elemente in das UMS integriert und auch die Anspruchsgruppen angemessen eingebunden, kann sich ein Unternehmen extern zertifizieren lassen. Als Grundlage bietet sich die neu entwickelte Norm IQ-Net SR 10 an, welche sich auf Vorgaben gemäss ISO 26000 bezieht und diese mit dem Managementsystem-Zyklus verbindet.
Kommunikation und Berichterstattung
Mit diesen Schritten ist das Nachhaltigkeitsmanagement weitgehend umgesetzt. Lediglich ein zusätzliches, aber potenziell sehr interessantes Element fehlt: eine Kommunikation des Engagements und der Erfolge durch eine öffentliche Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch hier ergeben sich klare Synergien zum UMS. Mit dem (internen) Management- Review besteht bereits ein erstes Raster, welches zwar nur Umweltaspekte erfasst, aber Ausgangspunkt für die Ergänzung der beiden anderen Nachhaltigkeitsaspekte, Gesellschaftlich-Soziales und Unternehmensführung, darstellen kann. Schematisch ist das Vorgehen in Grafik 2 dargestellt.
Erfahrungen aus unserer aktuellen Beratungspraxis zeigen diese Synergien sehr deutlich. Mehrere von uns begleitete Firmen haben ein zertifiziertes UMS, wodurch bereits eine grössere Menge von Elementen eines Nachhaltigkeitsmanagements vorhanden ist.
Eine Firma hat zunächst den CSRAnalyseprozess inkl. Anspruchsgruppenbefragung durchgeführt. Daraus ergab sich als wichtiger Prozess der Ablauflenkung die Kommunikation mit relevanten Anspruchsgruppen, insbesondere mit den wichtigsten Kunden. Daraufhin wurde eine Berichtstruktur erstellt, welche UMS-, GRI- und Kundenanforderungen miteinander verbindet. Je nach Zielgruppe wird aus einem Gesamtbericht, welcher auch als Management-Review Verwendung findet, ein Teil her-
Machen und darüber reden
ausgenommen. Dieser wird dem Hauptkunden mit besonders hohen Anforderungen an Informationen zur Verfügung gestellt. Ein kleinerer Teil wird als Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht werden.
Ein anderes Unternehmen hat als Hauptzielgruppe die Öffentlichkeit identifiziert. Hier werden zunächst die Kennzahlen auf Gesellschaftlich- Soziales sowie Unternehmensführung ergänzt und dann werden Strategie und Ziele entsprechend erweitert. Unter Nutzung vorhandener Daten und Dokumente lässt sich dies effizient und zugleich glaubwürdig bewerkstelligen. Darauf aufbauend wird ein Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an die derzeit noch gültige GRI-Version 3.1 erstellt. In einer späteren Phase erst soll der Nachhaltigkeitsbericht an die neue GRI-G4-Version angepasst werden, da diese einen verstärkten Einbezug der Anspruchsgruppen erfordert.
Auch wir selbst gehen den
Weg Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigt sich ausserdem an unserem eigenen Nachhaltigkeitsbericht der Neosys AG, den wir seit drei Jahren erstellen. Der öffentliche Bericht ist gegenwärtig der einzige GRI-Bericht in der Schweiz, welcher zugleich (um einen internen Abschnitt ergänzt) das UMS/ QMS-Management-Review und den Geschäftsbericht der Firma darstellt. Ausserdem wird er als Fortschrittsbericht beim UN Global Compact eingereicht. Auch hier ergeben sich also sinnvolle Synergien.
Abschliessend kann auch der Nachhaltigkeitsbericht durch die GRI dahingehend geprüft werden, ob er in seiner Abdeckung von Aspekten deren Anforderungen entspricht.