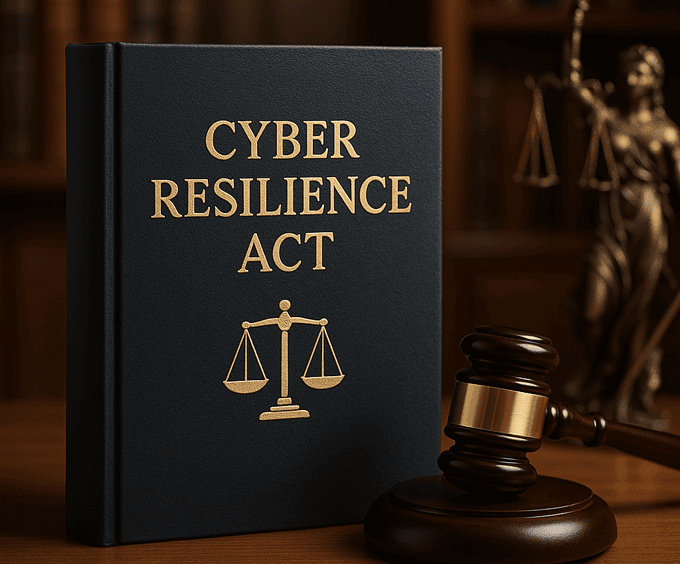Therapie-Apps mit Nebenwirkungen?
Es heisst, Gesundheits-Apps verlieren nach wenigen Wochen zwei Drittel ihrer Nutzer. Dies zeigt die «EPatient-Survey», eine jährliche Online-Erhebung. Allerdings informieren sich – wie weitere Ergebnisse aufzeigen – nicht alle Nutzer gleich über App-Empfehlungen. Die Anwender bedienen sich qualitativ unterschiedlicher Health- und Beratungs-Programme.

Die Forschungs- und Beratungsfirma EPatient RSD in Berlin coacht Versicherungen und Kliniken aus dem deutschsprachigen Raum. Bereits 2017 wiesen die EPatient-Analysten auf eine Divergenz in der Nutzung von Health-Apps hin: Weniger als einer von drei Gesundheits-App-Nutzern verwendete seine App noch nach ein paar Wochen (Quelle: EPatient-Survey 2017). Anderseits greift eine Mehrheit von privaten Nutzer und Nutzerinnen auf unstandardisierte Apps für Medikationen, Verhütungs- oder Diätprogramme zurück.
Wird es in Zukunft möglicherweise eine noch grössere qualitative Schere im mHealthBereich geben? Es kursieren Health-Apps en masse. Im Trend seien insbesondere Apps zu Themen der Prävention, Diagnose und Therapie. Am stärksten verbreiten sich laut der neusten «EPatient-Survey» vom 7. Mai 2018 «Coaching-Apps». Weiter befragte die Firma Umfrageteilnehmer zur Zahlungsbereitschaft für digital genutzte Gesundheitsdienste. Offensichtlich haben die Nutzer nicht viel dafür übrig, entsprechende Health-App-Leistungen zu bezahlen.
Die Bereitschaft, Apps zu abonnieren, nehme immerhin auf geringem Niveau leicht zu, so das Ergebnis. Andererseits weisen viele Health-Apps hin und wieder Update-Kinderkrankheiten auf, was die allgemeingültige Akzeptanz respektive Unterscheidung von Konsumenten- und Beratungs-Apps erheblich schmälert.
Markt und Standardisierung
Viele Patienten werden noch vom Gesundheitssystem in der Online-Welt alleine gelassen. Kurz vor der Einführung des elektronischen Patientendossiers in der Schweiz (siehe S. 21) und im Kontext von regionalen App-Anbietern im Versicherungswesen stellt sich die entscheidende Frage, ob überhaupt MedTech-Normen mit der allzu agilen Entwicklung des IT-Markts einhergehen.
Grundsätzlich initiieren die Versicherungen «Sprechstunden» auf mobilen Endgeräten, doch Herr und Frau Schweizer vertrauen den digitalen Gesundheitsstützen nicht zu jedem Preis. Ärzte, Kliniken und Krankenkassen konnten den einstigen Vertrauensvorsprung, den sie noch vor Apple und Google hatten, kaum (noch) ausnutzen, ausser, sie werben für ihre Produkte mit Gesundheitsaspekten.
Prüfsteine für eHealth-App-Nutzer:
- Trial and Error: Jeder dritte Teilnehmer testete mehr als eine App aus, um seine Ideal-App zu finden. Chronische Patienten scheinen hier aktiver zu sein. Zwei von drei App-Nutzern kamen mit der anfänglichen Bedienung gut bis einigermassen gut zurecht. Fast jeder achte brauchte dazu Hilfe von Dritten
- Selbstbeurteilung kontrovers: Ein Zweiwelten-Dilemma von der Versorgung vor Ort auf der einen Seite und den über 5000 Sites und Apps auf der anderen Seite stellt Gesundheitssysteme, Bürger und Patienten auf die Probe. Dabei wünscht sich der Patient eine verständliche und relevante digitale Orientierung von seinen Behandlern während und nach seiner Therapie.
- Markt schlägt Wissenschaft: Die von den Teilnehmern abgefragten AppProduktenamen zeigen: Evaluierte, gute Therapie-Apps (z.B. für Asthma, Depressionen, Herz und Kreislauf) haben ihre Zielgruppe im Markt gegenüber den Mainstream-Angeboten noch nicht ausreichend gefunden.
- Big-Data-Unterstützung: An die 70 Prozent der App-Nutzer sind bereit, ihre persönlichen Vital- und Krankheitsdaten für Forschungszwecken freizugeben. Kliniken und Ärzten würden die Befragten eher Datenzugang gewähren als den Krankenversicherern.
Über 300000 Gesundheits-Apps stehen auf den grossen Mobilplattformen zur Verfügung. Und es werden laufend mehr. «Der Regulierungsrahmen besteht und ist grundsätzlich genügend. Hingegen ist die Schaffung von Transparenz wichtig. Das Bewusstsein bei Entwicklern, dass ihr Produkt ein Medizinprodukt sein kann und dass es somit zertifizierungspflichtig ist, bleibt», erklärt Catherine Bugmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei eHealth Suisse. Im März 2018 hat eHealth Swiss den «Leitfaden für App-Entwickler, Hersteller und Inverkehrbringer» publiziert. Damit gibt die unabhängige Gesundheitsplattform einen Überblick über die wichtigsten Grundbegriffe, Prozesse bei der Abgrenzung von Lifestyle- und medizinischen Health-Apps.
Die Definition von Medizinprodukten ist gesetzlich in der schweizerischen Medizinprodukteverordnung definiert und entspricht als Umsetzung der europäischen Medizinrichtlinie dem gesamteuropäischen Rechtsrahmen zu Medizinprodukten. Gemäss der Definition kann auch Software als Medizinprodukt qualifiziert werden und somit den gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Leistung uterliegen.
Aufgrund der Revision der europäischen Medizinprodukterichtlinie (siehe Infobox rechts) werden Medizinprodukte in Zukunft strenger reguliert und medizinische Software in einzelnen Fällen einer höheren Risikoklasse zugeordnet. Zusätzlich zur Redefinition gibt es weitere Dokumente, die zur Entscheidungshilfe bei der Zuordnung zu Medizinprodukten bei Software dienen können (allen voran MEDDEV 2.1/6).
Medizinprodukte müssen mit den gesetzlichen Vorgaben konform sein und für den Nachweis der Konformität einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Um nachzuweisen, dass ein Produkt den Anforderungen entspricht, «kann» auf Normen zurückgegriffen werden – bei harmonisierten Normen ist dies dann sogar vorgesehen.
Ist eine Software gemäss gesetzlicher Definition kein Medizinprodukt, empfiehlt es sich trotzdem, den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden und involvierte Normen bei der Entwicklung zu beachten.
Der Arzt als Vertrauensperson
Anspruch und Wirklichkeit klappen jedoch in der Praxis noch weit auseinander. Ein springender Punkt bei der Definition von E-Health ist beispielsweise die Dauer der Zertifizierung. Wird eine Gesundheits-Applikation veröffentlich, kann es schon mal ein Jahr gehen, bis man alle Schwachstellen des angebotenen Produkts ausgelotet hat.
Die App-Nutzer mögen sich vielleicht zuerst auch kritisch gegenüber unbekannten Anwendungen geben, mit der Zeit würden sie jedoch alle ihre persönlichen Daten preisgeben: So können 58 Prozent der Befragten anfänglich nichts mit dem Begriff «Online-Gesundheitsakte» anfangen. Auf die Frage, ob sie digital jederzeit auf ihre Krankheitsdaten zugreifen wollen, antworten jedoch 73 Prozent mit Ja
In der siebten «EPatient-Survey», wofür über 8 400 App-Evaluationen erhoben wurden, zeichnet sich eines deutlich ab: das Bedürfnis der Befragten ihren Arzt als «Lotsen für digitale Versorgungslösungen» angehen zu können, steigt. Gegen 70 Prozent der befragten «Gesundheits-Surfer» seien bereit, ihre Daten mit ihrem Arzt zu teilen. Darauf folgen erst Kliniken und Krankenkassen. Zum Vergleich: Nur fünf Prozent möchten bei Apple oder Google ihre Patientendaten hinterlegen. Abschliessend heisst es in der Survey: Der Arzt ersetze keine App. Drei Viertel der Patienten besprechen die AppEmpfehlungen mit ihrem Arzt, selbst wenn die App eine «andere Therapie» empfiehlt. Mögen die Health-Apps von Morgen noch so interaktive Formen annehmen, letzten Endes liegt es an den Entwicklern, die Bedienungsfreundlichkeit akkurater, wenn nicht kompetenter auszugestalten.