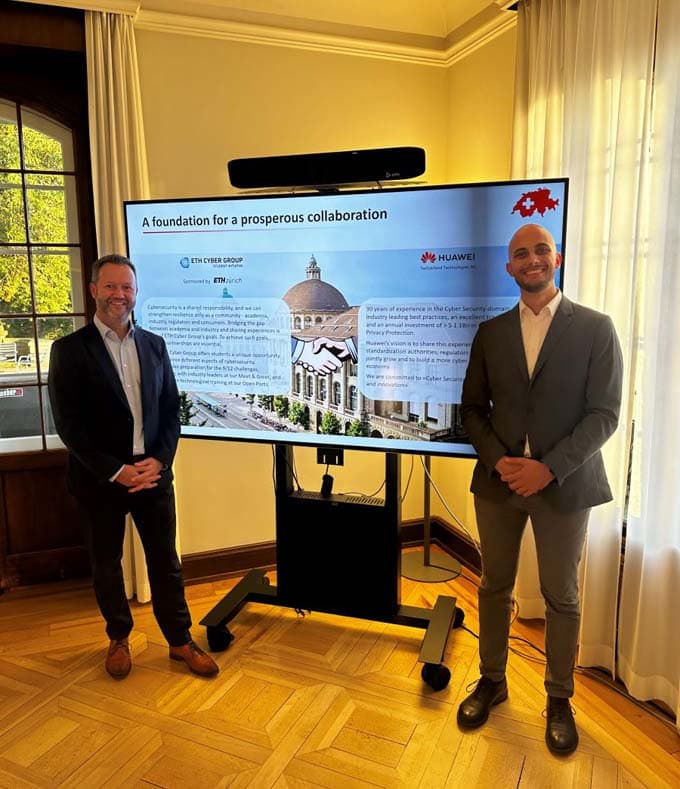Waldbrände effizienter aus der Luft bekämpfen
Ob in Kanada, Kalifornien oder im Mittelmeerraum – weltweit werden Wald-brände häufiger und vor allem heftiger. Hitze, Trockenheit und Wind machen Brände gerade im Sommer oft zum Inferno. Die Klimakrise verschärft das Problem. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI und das Start-up Caurus Technologies GmbH reagieren auf die zunehmende globale Bedrohung: Gemeinsam entwickeln sie ein innovatives Löschverfahren, mit dessen Hilfe sich grossflächige Feuer effizienter aus der Luft bekämpfen lassen.

Durch den Klimawandel ändert sich die Qualität der Waldbrände. Sie werden heisser und breiten sich schneller aus. Allein in Kanada brannte im Jahr 2023 eine Fläche von rund 185 000 km2 – also etwas mehr als die Fläche von Griechenland und der Schweiz zusammen. Auch hierzulande beginnt die Waldbrandsaison immer früher: In trockenen Gegenden wie Brandenburg standen die ersten Hektar Wald bereits am 1. März dieses Jahres in Flammen. Mit einem neuartigen Löschverfahren wollen Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer EMI in enger Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Caurus Technologies GmbH einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung von Waldbränden aus der Luft leisten. Das modulare System, bestehend aus Hard- und Software, vereint Digitaltechnologie mit innovativen Löschansätzen und ergänzt die herkömmlichen Löschmethoden. Das Fraunhofer Ahead-Programm fördert das Projekt.
Hoher Löscheffekt durch gezielt erzeugte Wasser-Aerosol-Wolke
Die heutige Technik der luftgestützten Brandbekämpfung stammt grösstenteils aus den 70/80er-Jahren. Noch immer fliegen Helikopter oder Flugzeuge mit Löschwasser-Buckets über die brennenden Wälder. Bei einer Flughöhe von 40 bis 50 Metern öffnen die Piloten den Boden des Eimers. Winde und Thermik verwehen das Löschwasser, das sich dann grossflächig verteilt – infolgedessen landet nur eine geringe Menge tatsächlich in den Flammen.
«Wir können Feuerwehren bessere und nachhaltigere Löschmethoden an die Hand geben und die Löschwassermenge mit verbesserter Abwurfpräzision durch digital gestützte Steuerung zielgenau einsetzen», sagt Dr. Dirk Schaffner, Wissenschaftler am Fraunhofer EMI in Freiburg. Die Projektpartner arbeiten ausserdem an einem Öffnungsmechanismus, der eine deutlich effizientere Löschwolke hervorruft. Dieser ermöglicht sowohl möglichst kleine, feine Wassertropfen als auch die präzise Platzierung der Löschwolke nahe am Brandherd. Diese Faktoren beeinflussen den Löscherfolg entscheidend, indem sie helfen, die Temperatur des Feuers schnell zu senken und unter den Entzündungspunkt zu bringen sowie dem Feuer breitflächig den benötigten Sauerstoff zu entziehen.
«Durch den Mechanismus können wir gezielt eine Wasser-Aerosol-Wolke erzeugen, die in einer Höhe von einigen Metern über oder in den Flammen aktiviert wird. Das Wasser wird so nicht vorher auseinandergetrieben, sondern in einem Sack bis knapp über dem Brand zusammengehalten. Nahezu 100 Prozent der Wassermenge landen zielgenau in den Flammen», so Schaffner. Mit der Wasser-Aerosol-Wolke gelingt es, dem Feuer sehr schnell die Hitze zu entziehen. «Die Wärmetransferrate, mit der man Energie aus einem System nehmen kann, ist oberflächenabhängig. Je mehr Oberfläche das aufnehmende Medium zur Verfügung stellt, desto schneller wird die Wärmeenergie aus dem brennenden in das aufnehmende Medium transferiert. Und die Aerosol-Wolke weist eine hohe Oberfläche auf», erläutert der Forscher. Mit einer Aerosol-Wolke lasse sich also eine deutlich höhere Wärmetransferrate erreichen als mit einem Block Wasser.
Auch die Verdrängung von Sauerstoff funktioniere sehr gut, wodurch sich der Verbrennungsprozess abschwäche. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Kompatibilität mit erfolgreichen bestehenden Lösch-taktiken am Boden und der Sicherheit aller Einsatzkräfte.
Effizienz des Wassereinsatzes vervielfacht sich
Die neue Technologie bzw. die Aerosolisierung von Wasser kommt heute bereits in Hochdruck-Dispersionsdüsen, die die Feuerwehr am Boden nutzt, zum Einsatz – die Forschenden am Fraunhofer EMI und Caurus Technologies wenden sie nun erstmals in der Luft an und erweitern damit die Einsatzgebiete erheblich. Aufgrund von Studien erwarten die Projektpartner eine um fünf- bis zehnfach erhöhte Löschwirkung im Vergleich zu aktuellen Systemen. «Pro eingesetztem Liter Wasser können wir ein fünf- bis zehnfach grösseres Feuer mit dem neuen Verfahren löschen», betont Schaffner einen Vorteil der Technologie angesichts weltweit immer knapper werdenden Wasserressourcen. Auch die Sicherheit der Einsatzkräfte ist gewährleistet, da sie nicht unnötig nah an die Brandherde heranfliegen müssen und höhere Abwurfdistanzen einhalten können.
Ein weiterer Pluspunkt: Die neue Löschmethode trägt zur Reduktion von CO2 bei, da Vegetationsbrände sich deutlich schneller eindämmen lassen. Denn Waldbrände sind ein immenser CO2-Verursacher: Im Durchschnitt wurden in den letzten 20 Jahren pro Jahr 6,9 Gigatonnen CO2-Emissionen durch Waldbrände freigesetzt. Das entspricht mehr als dem Doppelten der Emissionen aller 27 Mitglieder der Europäischen Union im gleichen Zeitraum.
Erste Prototypen des innovativen Löschverfahrens wurden bereits erfolgreich getestet, aktuell arbeiten die Projektpartner an einem Demonstrator.
Quelle: www.fraunhofer.de